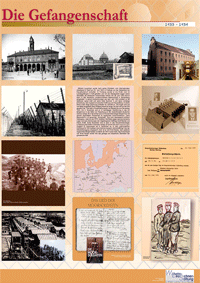Die Zeit in Berlin 1933 bis 1944 Verfolgung und Widerstand
Wilhelm Leuschner ist als hessischer Innenminister ein erbitterter Gegner der Nationalsozialisten. Im Januar 1933 wird er in den Bundesvorstand des ADGB gewählt und repräsentiert diesen im Internationalen Arbeitsamt in Genf (als Folge des I. Weltkriegs 1919 gegründet). Zur Zeit der Machtübertragung an Hitler am 30. Januar 1933 ist Leuschner in Genf, bei einer Arbeitszeitkonferenz. Anfang Februar 1933 wird er nach Darmstadt in die geschäftsführende Regierung der Weimarer Koalition zurückgerufen. Der Nazi - Reichsinnenminister Wilhelm Frick übt Druck auf die Regierung des Volksstaates Hessen aus, Leuschner als Innenminister zu entlassen. Am 26. Februar 1933 tritt er mit Wirkung zum 1. April 1933, auch wegen mangelnder Unterstützung der SPD-Fraktion, als Innenminister zurück. Zur Reichstagswahl am 5. März 1933 ist er für die SPD Wahlredner und fordert alle Demokraten auf: „Jeder bleibe an seinem Platz und verteidige die Republik“. Am 6. März wird sein Ministerium am Darmstädter Luisenplatz von der SA besetzt und die Wohnungen des Staatspräsidenten Adelung und des Innenministers Leuschner werdenvon SA-Banden durchsucht. Die Ausübung des Ministeramts ist zu diesem Zeitpunkt für Leuschner nicht mehr möglich und er zieht nach Berlin (die Familie holt er im Mai nach), um für den ADGB zu arbeiten. Im März und April 1933 knüpft er Kontakte zu den anderen weltanschaulich organisierten christlichen, liberalen und deutsch-nationalen Gewerkschaften, um eine Einheitsorganisation als Bollwerk gegen die Gleichschaltungspläne der Hitler-Regierung zu schaffen. Das Diskussionspapier des so genannten ‚Führerkreises der vereinten Gewerkschaften beinhaltet die Organisationsform und –ideologie dieser neuen, alle Arbeitenden umspannenden Einheitsorganisation der Arbeit. Er trifft sich mit Jakob Kaiser und Theodor Brauer, von den christlichen Gewerkschaften, Ernst Lemmer und Anton Erkelenz von den Hirsch-Dunkerschen Gewerkvereinen und Max Habermann vom Deutsch-Nationalen Handlungsgehilfenverein. Das Dokument des Führerkreises ist einerseits Ausdruck des Anpassungskurses der deutschen Gewerkschaften an die NS-Machthaber, wie auch des sich regenden Widerstands gegen den NSTerror und der Gleichschaltung. Der 1. Mai wird vom NS-Regime zum ‚Tag der nationalen Arbeit' als Feiertag gesetzlich verankert und im Berliner Lustgarten tritt Hitler gemeinsam mit Hinderburg vor der ‚deutschen Jugend' auf. Anschließend wird auf dem Tempelhofer Feld bei einem Massenaufmarsch von mehr als hunderttausend Menschen in Uniformen der SA und des NS-Arbeitsdienstes von Hitler die Volksgemeinschaft beschworen. Diese soll den Klassenkampf überwinden und ‚Volksfeinde‘ ausgrenzen. Leuschner und Kaiser sind, trotz des Aufruf des ADGB an seine Mitglieder zur Teilnahme an den Kundgebungen zum 1. Mai, nicht dabei. Am 2. Mai 1933 werden die Gewerkschaftshäuser im ganzen Reich von der SA gestürmt und die führenden Funktionäre verhaftet. Leuschner wird mit dem ADGB-Vorstand im Haus an der Wallstraße in Berlin verhaftet und bis zum 5. Mai eingesperrt. Anschließend muss er mit dem zukünftigen Führer der ‚Deutschen Arbeitsfront' (DAF), Robert Ley, im Juni 1933 nach Genf und soll dort die NS-Herrschaft legitimieren. Er weigert sich und informiert die internationalen Gewerkschafter und Arbeitgebervertreter über das wahre Gesicht der NS-Herrschaft. Bei der Rückkehr nach Deutschland wird er verhaftet und der einjährige Leidensweg durch die Konzentrationslager beginnt.
Nach der Freilassung aus dem Konzentrationslager Lichtenburg trifft sich Wilhelm Leuschner mit ehemaligen A D G B - Gewerkschaftsfunktionären und mit Jakob Kaiser von den christlichen Gewerkschaften im Berliner Cafe Kranzler. Sie besprechen die Pläne des Widerstands und verabreden die Kontaktnahme
mit anderen Widerstandsgruppen aus dem kirchlichen, bürgerlichen und militärischen Lager. Leuschner kommt als ehemaliger Innenminister die Schlüsselrolle zu, diese Kontaktezu knüpfen. Neben dem Aufbau von Widerstandszellen gegen das Naziregime ist er damit beschäftigt, sich eine Existenzgrundlage aufzubauen, da ihm der hessische Nazi-Ministerpräsident Philip Jung im Juni 1933 seine Ministerpension gestrichen hatte. Leuschner und seine Familie mussten, wie der Brief seines Sohnes von 1934 zeigt, ohne jegliches Einkommen mit geliehenem Geld ihre Existenz sichern. Im Dezember 1936 gelingt es ihm, eine kleine Metallfabrik in der Eisenbahnstraße 5 in Berlin-Kreuzberg zu erwerben, die Eröffnungsbilanz zeigt ein Einlagevermögen von 5.200 Reichsmark. Mit diesem Anfangskapital, das er gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Bachmayer aufbringt, eröffnet er die Firma Leuba, in der er frühere Genossen aus der Arbeiterbewegung beschäftigt. Mit einem Patent von Ernst Schneppenhorst, der eine Metalllegierung entwickelte, produzierte er Bierschankutensilien. Der Vertrieb der Produkte führte ihn als Verkäufer seiner Erzeugnisse in viele ehemalige Gewerkschaftshäuser, die jetzt von der Deutschen Arbeitsfront beschlagnahmt waren. In dieser zweiten Phase des Widerstands gegen die Nationalsozialisten vor dem Weltkrieg gelang es ihm, in allen Reichsländern Untergrundgruppenvon gewerkschaftlichen Vertrauensleuten aufzubauen. Bis zum August 1939 hat er die Kontakte über Generaloberst Kurt Hammerstein-Equord zu den Militärs entwickelt. Die Militärs um Kurt von Hammerstein-Equord und Generaloberst Ludwig Beckwaren von Anfang an gegen Hitlers Kriegspläne und schmiedeten als Reichwehroffiziere bereits 1933 Umsturzpläne gegen das Hitlerregime. Als hessischer Innenminister hatte Wilhelm Leuschner schon in der Weimarer Republik Kontakt mit diesen Militärs, was ihm die Zusammenführung unterschiedlicher weltanschaulicher Lager des Widerstand erleichterte.